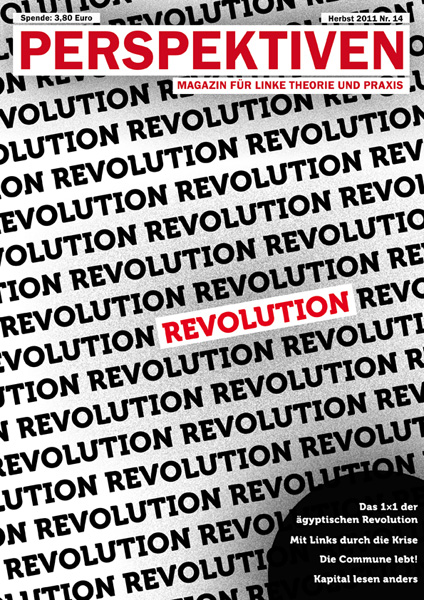Philipp Probst sprach mit Kamile Batur und Baruch Wolski vom Kulturverein Kanafani über Islamophobie, Rassismus und die Konstruktion europäischer Identitäten.
Was sind eure Erfahrungen mit Islamophobie? In welcher Form seid ihr Rassismus ausgesetzt, was gibt es für Alltagserfahrungen?
Baruch Wolski: Es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt AktivistInnen vom Kulturverein Kanafani, die kaum damit konfrontiert worden sind und dann gibt’s welche, die sehr stark damit konfrontiert worden sind, durch Pöbeleien etc. Vor allem Frauen mit Kopftuch trifft das besonders, weil die einfach sichtbar sind.
Kamile Batur: Es gibt auch Fälle, die jedeN von uns betreffen. Aber wenn man Kopftuch trägt, dann wird man schon zur Zielperson gemacht, überall, auf der Straße, usw. Oft merkt man es vorher gar nicht. Leute, die aus der Mittelschicht kommen, die eigentlich ganz ordentlich ausschauen, machen irgendwas, und zwar so, dass die Anderen das nicht merken, nur du merkst das. Wenn du das dann schluckst, ist alles in Ordnung, weil sie ja auch erwarten, dass du als Frau mit Kopftuch immer schüchtern bist, dass du nicht reagieren kannst. Wenn du einmal reagierst, dann laufen sie schnell weg, dann können sie nicht mehr weiter machen. (lacht) Ich bin nicht so oft betroffen, aber es gibt schon Fälle, in denen es auch zu körperlichen Übergriffen gekommen ist.
B.: Es gibt etwas, das man zum Teil nur schwer in einer Statistik, wie sie zum Beispiel Zara 1 erstellt, fassen kann. Es gibt einfach Nuancen, Untertöne im Umgang miteinander. Ahmed beispielsweise, dessen Eltern Freunde von uns sind, ist fünf Jahre alt. Wir fahren mit ihm und unserem Kind in den Zoo. In dem U-Bahnwagon sitzt eine alte Frau und fängt an mit den Kindern zu sprechen, ganz lieb eigentlich und sehr freundlich. Aber irgendetwas spürt man da. Und dann sagt sie: „Ja aber der ist nicht euer Kind“, weil er dunkler ist. Und wir sagen: „Kind von Freunden“ und sie „Achso, jaja,… na, als Kinder sind sie schon sehr lieb alle“. Das kann man jetzt nicht großartig als Übergriff werten und manchmal ist es, wie es rüberkommt, sogar noch diffiziler als in diesem Beispiel. Es sind diese unterschwellige Sachen, die an einem nagen und statistisch auch nicht so gut erfassbar sind.
K.: Für mich ist nicht so sehr der Rassismus im Alltag das Problem. Ich kenne auch viele nette Leute, die fast schon übernett sind. Ich finde der institutionelle Rassismus ist viel schlimmer und hat größeren Einfluss, gerade auch auf unser alltägliches Leben.
Wie wirkt sich dieser institutionelle Rassismus aus?
B.: Das bezieht sich ja nicht nur auf Islamophobie, jedeR hat Probleme mit Fremdenrecht usw.
K.: Ich bin, zum Beispiel, seit über fünf Jahren mit einem österreichischen Staatsbürger verheiratet, trotzdem bekomme ich bis heute nur ein einjähriges Visum.
B.: Auch auf der Uni. Oft sind die Menschen an den Inskriptionsstellen für ausländische Studierende furchtbar, insbesondere auch zu den türkischen Studierenden.
Was auch zum institutionellen Rassismus, vielleicht nicht direkt, dazugehört, ist, was als mediales Bild vermittelt wird.
K.: Das gehört auch zum institutionellen Rassismus. Staatliche Stellen, Medien und auch zivile Stellen sind ein Teil davon.
Ihr habt das mediale Bild angesprochen. Islamophobie ist ja ein Phänomen, das sich in den letzten Jahren immer mehr verschärft hat, jüngster Höhepunkt waren die Aussagen im FPÖ-Wahlkampf in Graz. Was glaubt ihr waren die Ereignisse, die das noch verschärft, noch einen zusätzlichen Aufschwung gegeben haben?
K.: Solche Ereignisse find ich nicht so schlimm. Jeden Tag sehe ich irgendetwas in den Printmedien oder im Fernsehen, was nicht so klar rassistisch ist, aber diese Propaganda irgendwie verschärft. Fälle wie in Graz machen den Rassismus nur sichtbar und wir können dann offen über Rassismus sprechen. Aber wie die Medien das machen, da darfst du nicht so offen über Rassismus sprechen – da wirkt das viel versteckter.
B: Als Islamkritik, oder demokratischer Diskurs. Ich meine, alles was Susanne Winter gesagt hat, das ist ja nicht original von ihr. Das mit dem Tsunami, das hat Henryk Broder schon einmal gesagt und „Mohammed ist ein Perverser“ kam von Ayaan Hirsi Ali. Das hat niemals dieses Echo ausgelöst, weil es damals einfach Teil des demokratischen Diskurses war und von „KritikerInnen“ gekommen ist. Wenn Susanne Winter das sagt, ist die ganze Republik entrüstet. Wobei auch diese Entrüstung wieder ein Problem ist. Wenn gesagt wird, „um Gottes willen, die bringt die Österreicher in eine gefährliche Sicherheitslage“ ist das ja auch kein antirassistisches Statement, sondern eher eine Fortführung dieser Klischees und Panikmache.
Islamophobie wird oft mit einer Wertediskussion verbunden, in der es dann um „österreichische Werte“ oder „europäische Werte“ geht. Wie steht ihr dieser Wertediskussion gegenüber?
K.: Ehrlich gesagt in anderen Ländern, in Holland, Dänemark, England oder auch Deutschland ist das irgendwie noch schlimmer als in Österreich. Was sollen diese Werte sein? Was ist die Leitkultur von Wien? Das sind so abstrakte, in der Luft schwebende Begriffe. Bis jetzt haben Leute immer zusammen gelebt, es gibt keine „reine“ Kultur in Europa, sondern immer gemischte Kulturen in Europa und in Österreich. Die Immigration ist doch nichts Neues in Österreich und hat eine mehr als zweihundertjährige Geschichte. Trotzdem wird immer noch davon gesprochen, als gäbe es eine homogene Kultur, ein homogenes Wertesystem, und nur die Muslime wären das nicht „anpassungsfähige“ Element. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was diese reine, homogene Leitkultur von Österreich oder von Europa sein soll.
B.: Ich glaube, die sind sich auch nicht sicher. Deshalb nimmt man auch den Islam als Projektionsfläche, um das zu definieren. Es ist Ausdruck einer Identitätskrise und gleichzeitig auch der Versuch, eine europäische Identität zu schaffen, zu konstruieren. FreundInnen von KanakAttak2 waren bei uns für einen Workshop zu Besuch und haben gemeint, dass das einzig verbindende Element in allen europäischen Ländern derzeit eigentlich die Islamophobie ist. Es gibt keine gemeinsame Sicherheitspolitik usw., man einigt sich eigentlich auf gar nichts, aber man versucht zumindest eine europäische Identität zu konstruieren. Das funktioniert eigentlich fabelhaft. Und es funktioniert auch deshalb, weil die Linke in einer Krise oder kaputt ist. Die neuen sozialen Bewegungen sind alle nicht mehr neu, sondern eher alt. Dann kannst du im Falter lesen, der ja auch so ein Überbleibsel ist, wir dürften uns unsere christlichen Werte nicht von der FPÖ verteidigen lassen, wie Armin Thurnherr schreibt. Was hat er mit christlichen Werten zu tun? (lacht). Ein anderes Beispiel: Wir waren bei einer halb-internen Wertediskussion bei den Grünen eingeladen, bei der sie dann sagen: „Wir haben schon europäische Werte, und die soll man auch möglichst unterschreiben. Das ist dann die europäische Menschenrechtserklärung“. Interessant, alles was von der Linken übrig geblieben ist, ist die europäische Menschenrechtserklärung, die man ja auch durchaus von links kritisieren könnte. Das ist das Bedrückende, dass sich das überall durchzieht und nicht nur bei der Rechten bleibt. Dass man damit seine eigene Identität konstruiert. Plötzlich sind alle ganz frauenbewegt. Ich war bei einer Gemeinderatssitzung der FPÖ, wo die Burschenschaftler sitzen und über Frauenrechte reden, im Bezug auf den Islam. Es ist ein Phänomen! (lacht)
K.: Es ist wirklich interessant, dass alle so mitspielen. Auch FeministInnen, wenn auch nicht alle, und viele marginalisierte Gruppen. Das ist das große Problem mit der Islamophobie, dass es nicht nur ein Problem der Rechten, sondern auch der Linken ist.
Das Thema Integration spielt in diesem Zusammenhang ja eine große Rolle.
B.: Ja, plötzlich werden nicht mehr „die Ausländer“ sondern „die Muslime“ integriert. Besonders auffällig war das bei dem Integrationsbericht unter Liese Prokop, in dem es eigentlich um Muslime gegangen ist. Es wurden einfach die Kategorien ausgetauscht.
K.: Mit dem Begriff Integration haben wir natürlich auch unsere Probleme.
B.: Aber nicht nur wir, weil wir eine theoretische Kritik daran haben, sondern auch die MigrantInnen selbst.
K.: Integration ist ja nicht einfach der Begriff zwischen Multikulturalismus und Assimilation. Es ist einfach eine Reformulierung von Assimilation. Wir haben uns viele Studien angesehen, und es wird nie genau definiert, was diese Werte sind, worin die Leute integriert werden sollen. Was immer klar wird ist, dass die Religion, in dem Fall der Islam, ein Hindernis für Integration darstellt.
B.: Das ist die Prämisse.
K.: Da sieht man schon warum diese Studien gemacht werden.
B.: Das verstehen auch alle! Die Gastarbeiter aus Anatolien verstehen ganz genau, wie das gemeint ist. Wenn man „Integration“ sagt, wissen sie: das heißt eigentlich, wir sollen uns assimilieren, anpassen, unauffällig werden. Das wird durchaus so richtig verstanden.
Ihr habt vorher angesprochen, dass sich Islamophobie nicht nur auf rechte oder konservative Kreise beschränkt, sondern sich auch in linke und liberale Kreise ausbreitet. Warum ist das so? Warum hat das so eine Massenwirkung?
K.: Sie glauben alle an die europäische Identität.
B.: Ich glaub es kommt von verschiedenen Richtungen. Zum Beispiel die 68er: in Österreich gab es zwar keine 68er, aber es gab da irrsinnig viele Leute aus dem Bürgertum und Kleinbürgertum, die offen waren für das, was damals passiert ist. Jetzt ist das alles irgendwie zusammengebrochen und fast nichts ist übrig geblieben – gerade auch nach 1989. Und nun rennen die Leute wieder zu Mama und Papa, zu dem, was für sie sicher ist, ins bürgerliche Elternhaus (lacht), wo dann gesagt wird „jaja, unsere christliche Werte“ und „wir Europäer“.
Es kommt immer aus zerbrochenen Geschichten. Wenn du dir die Antideutschen anschaust, die kommen aus einer radikalen Linken die zusammengebrochen ist, aus einer autonomen Bewegung, die sich zerstreut hatte. Die tragen das ganz stark, weil sie meinen, dass sie jetzt Teil eines Kulturkampfes zwischen Israel und dem Islam wären, und da müsse man dann mit Begeisterung dabei sein. Die Islamophobie hat ganz verschiedene Gründe. Aber es kommt immer aus einer eigenen Krise. Insofern knüpft das auch an einen alten Orientalismus an, wie ihn Edward Said beschrieben hat, und wie er in der Konstituierung Europas wichtig war. Das Andere erklärt einen selbst. Die Linke ist in einer schweren Krise und das ist ein Ausdruck davon.
K.: In der Orientalismusdebatte gibt es immer einen Islam, der einheitlich ist, wie Europa mit seiner Leitkultur, ein einheitliches Bild „des Islams“. Aber auch die, die das kritisieren, die versuchen aus dem Kulturkampf auszubrechen, laufen meiner Meinung nach in einer Falle, weil sie sagen, dass es eigentlich gar keinen Islam gibt. Das sind zwei unterschiedliche Ecken und wir stehen in keiner der beiden. Es gibt unterschiedlich praktizierte Islambilder aber trotzdem kann man von einem gemeinsamen Kern im Islam reden. Es gibt schon ein islamisches Weltbild mit einem gemeinsamen Kern, aber es ist nicht einheitlich, nicht homogen.
Vielleicht soll man einfach davon weggehen und darüber reden, wie wir zusammenleben können. Wir, also der Kulturverein Kanafani, sind vielleicht so ein Beispiel, wie man zusammen leben und arbeiten kann.
Wie schätzt ihr die Reaktion der radikalen Linke zum Thema Islamophobie ein?
B.: Ich glaube, in Wien hat der Israel/Palästinakonflikt alles überschattet – obwohl das in den letzten Jahren etwas aufgebrochen ist. Aber trotzdem gibt es diese Angst. Du bist anti-religiös und willst nichts verteidigen. Bezeichnend war die Demo, unterstützt von ÖH, Uni-Linken, EKH usw., ausgelöst durch die Demonstration der Faschos gegen die „Moschee“ im zwanzigsten Bezirk. Das war eigentlich das Thema. Sie haben es aber nicht geschafft „Islamophobie“ in den Aufruf zu schreiben. Sie haben dann die Formulierung, unter Sexismus, Rassismus, und alles was es so gibt, gefunden: „auch Menschen, die als Muslime wahrgenommen werden“. Wenn man böse ist, kann man da auch sagen, „bei echten Muslime is eh wurscht, oder was?“. Das ist ein Ausdruck davon, dass man nicht weiß, wie man damit umgehen kann, dass es ein großes Unbehagen gibt.
Zum Teil spiegeln sich auch Konflikte wider, die von ganz woanders kommen. Die meisten muslimischen Leute in Österreich sind türkischer Herkunft. In der Türkei gibt es einen Kampf zwischen alter kemalistischer Elite und Leuten aus der Peripherie, die vielleicht AKP wählen, und einer neuen Generation, die jetzt an die Uni strömt, oder schon da ist, und den alten Eliten die Posten streitig macht. Das selbe hast du im Mikrokosmos Wien auch. Die säkularen Linken aus der Türkei, die vor dreißig, vierzig Jahren mit guter Ausbildung gekommen sind und heute Verwaltungsbeamte im Wiener Rathaus oder Integrationsexperten sind,
K.: … also schon integriert sind (lacht)
B: … die haben riesigen Stress, dass jetzt eine Generation von muslimischen Leuten kommt, die auch gut ausgebildet ist, deren Eltern und Großeltern aber aus Anatolien kommen und Bauern waren, nicht aus der Stadt und aus Istanbul, und die jetzt auch ihre Stimme erhebt.
Plötzlich sagt dann diese ältere Generation: „Wir sind die Bastion gegen den ‚Islamismus’ und die Linken, wir Linken müssten doch den Islamismus bekämpfen.“ Da geht’s dann eigentlich um ganz banale Sachen, um einen Konflikt in der Türkei, der auch hier sichtbar wird.
K.: Zu Symposien oder Veranstaltungen zum Thema Kopftuch, Islam, oder EU-Beitritt der Türkei werden zum Beispiel immer unbedingt Leute türkische Herkunft eingeladen. Der Mann oder die Frau vertritt dann sehr oft eine eigenartige Sichtweise, und ich frag mich immer, warum, wenn es um die Kopftuchfrage geht, nie eine Frau mit Kopftuch gefunden wird, um dort zu sprechen. Gibt es die nicht? Das ist auch eine institutionalisierte Praxis von Rassismus.
B.: Dass immer die anderen über einen, über Muslime reden.
Wie schaut eure anti-rassistische Arbeit konkret, als Kulturverein Kanafani, aus?
B.: Wir sind eher im studentischen Umfeld aktiv und machen Veranstaltungen auf der Universität. Islamfeindlichkeit ist natürlich ein Schwerpunkt, auch auf Grund der Herkunft unserer AktivistInnen. Medienarbeit ist uns sehr wichtig. Wir bringen ein Magazin3 heraus und versuchen, in den akademischen Diskurs zu intervenieren.
K.: Das Problem ist, dass MigrantInnen oft gar nicht in diesen Diskurs hineinkommen. Dabei spielen wir schon eine Rolle, dadurch, dass wir diesen Diskurs auch irgendwie lenken können. „Islamophobie“ war zum Beispiel vor ein paar Jahren, als wir unsere Islamophobie-Reihe veröffentlichten, noch gar kein Thema. Es wurde nie gesagt, dass es so ein Problem gibt. Es muss erst sichtbar gemacht werden, dafür muss viel gearbeitet werden.
Deshalb haben wir eine Vortragsreihe gemacht und Texte im „der.wisch“ veröffentlicht.
B.: Als wir mit dem Thema Islamophobie angefangen haben, hat noch keiner davon gesprochen.
K.: Es wurde gesagt: „Was hat Islamfeindlichkeit mit Rassismus zu tun? Rassismus kommt doch von Rasse?“
B.: Dazu kommt, dass in Österreich der antirassistische Diskurs extrem unterentwickelt ist, im Vergleich zum angelsächsischen Raum oder selbst zu Deutschland. Zum Beispiel heißt das ÖH-AusländerInnen Referat noch immer AusländerInnenreferat. Ich weiß nicht, wie viele Diskussionen über Begrifflichkeiten es gab. Auch, dass es eigentlich nur eine Serviceeinrichtung ist und keine antirassistische Arbeit macht, gehört dazu. Es gibt kaum ein Bewusstsein dafür. Auch die meisten Studierenden haben gesagt: „Rassismus hat etwas mit Rasse zu tun. Wenn’s keine Rasse gibt, kann es auch keinen Rassismus geben.“ Das ist ein Niveau, unglaublich, da waren die Leute vor dreißig, vierzig Jahren weiter. Das ist nochmal eine österreichische Spezialität.
Damals als die doppelten Studiengebühren für ausländische Studierende gekommen sind, wollten wir einen Bettelzug machen.
K.: Da gab es auch Probleme. Die ÖH war nicht wirklich solidarisch mit den ausländischen Studierenden. Das Problem für die ÖH war, dass Frauen mit Kopftuch so zahlreich auf der Demonstration erscheinen werden.
B.: Es hieß zuerst, sie unterstützen die Demonstration ausländischer Studierender und derer, die hauptsächlich davon betroffen sind, also türkischer Studierender. Aber es sollen nicht viele Frauen mit Kopftuch kommen. Da haben wir gesagt, dass die aber die Betroffenen sind, worauf sie gesagt haben, dass das schlecht wäre, weil sie die Demo dann nicht mehr unterstützen könnten.
Wie geht man damit um?
B.: Man hat es dann ohne Unterstützung der ÖH gemacht, die Demo war halt kleiner. Schön war in diesem Zusammenhang, dass sich die türkischen linken Gruppen, auch die radikalen linken Gruppen solidarisiert haben. Da war das keine Frage, ob mit Kopftuch oder nicht. Das hat auch die Vorgeschichte, dass sie sich in der Türkei teilweise auch schon solidarisiert haben gegen das Kopfuchverbot. Von der ÖH gab es halt keine Unterstützung. Sie haben dann vorgeschlagen, es solle doch eine Arbeitsgruppe zum Thema doppelte Studiengebühren geben (lacht).
Wie steht ihr zur „Kopftuchdebatte“?
K.: Wir machen eigentlich nicht viel dazu. Für mich ist die Frage des Kopftuchs nicht nur eine Frage von Frauenrechten, sondern es ist auch ein Instrument für die Islamfeindlichkeit. Deswegen muss man allgemein Islamfeindlichkeit, Islamophobie bekämpfen. Zwei Behauptungen werden ja aufgestellt. Die eine ist, dass Frauen im Islam unterdrückt werden und das Kopftuch das Symbol dafür ist. Die andere ist, dass es ein Bild für Islamismus ist, für ein die europäische Identität gefährdendes Element. Wir reden immer über diese Konstrukte. Man muss Islamophobie allgemein bekämpfen.
B.: Wir haben das Kopftuch als Kopftuch nie thematisiert und es war auch vereinsintern nie ein Thema. Was sollen wir auch sagen? Wir sind nicht unterdrückt?
K.: Ich bin auch eine moderne Frau! (lacht) Um mit Islamophobie umzugehen, muss ich offen legen, was sie mit der ganzen europäischen Identität meinen. Es gibt Frauen in Köln, die legen Reinterpretationen des Islam aus theologischer Sicht vor, beschäftigen sich mit Koranversen etc. Die machen das auch gut, aber das ist kein politisches Instrument für uns. Es geht uns nicht darum, ob die Lage der Frauen im Islam richtig ist. Es geht uns darum, wie die europäische Identität konstruiert wird und wie man damit umgeht. Das wird nie enden. Jetzt ist es gerade der Islam, dann wird es wieder etwas anderes sein.
Danke für das Interview!
1 „Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit“: www.zara.or.at
2 www.kanak-attak.de
3 Das Magazin heißt „der.wisch“: www.kanafani.at/index_derwisch.html
Artikel drucken
Newsletter Abonnieren